Die Fachschule Münster-Wolbeck bietet eine Weiterbildung zum Staatlich geprüften Wirtschafter und Landwirtschaftsmeister in Teilzeitform als E-Learning-Angebot an. Das ist bisher einzigartig in NRW.

Foto: Marion Feldhaus, Landwirtschaftskammer NRW
Die hybride Form der Teilzeitweiterbildung gibt es erst seit 2023 an der Fachschule in Münster. Das Fachschuljahr erstreckt sich dabei insgesamt über zwei Jahre und beinhaltet die Abschlussprüfung zum Staatlich geprüften Wirtschafter. Eine gleichzeitige beziehungsweise anschließende Meisterprüfung sei möglich, aber kein Muss, erklärt Schulleiter Wolfgang Grab. Mit insgesamt 1 200 Stunden ist die berufsbegleitende Variante kompakter als die zweijährige Vollzeit-Fachschule, jedoch intensiver als etwa die Meistervorbereitungskurse in anderen Bundesländern.
In der dualen Ausbildung erfüllt die Weiterbildung zum Staatlich geprüften Wirtschafter in Teilzeit das DQR-Niveau 5 (Deutscher Qualifikationsrahmen). Mit dem Anschluss der berufsständigen Meisterprüfung, abgenommen von der Landwirtschaftskammer NRW, erreichen die Absolventen auch die Ausbildungsbefähigung, die für eine Betriebsleitung und -führung notwendig ist. Sie entspricht dann dem DQR-Niveau 6 aus der vergleichenden Vollzeitvariante.
Doch nicht nur deswegen nutzen Schüler aus verschiedenen Teilen des Bundeslandes das Angebot der Münsteraner Fachschule. „Mit einer einfachen Ausbildung kommt man heutzutage in der Landwirtschaft nicht mehr weit“, erklärt der Schulleiter das allgemein hohe Interesse an Weiterbildungsangeboten von Fachschulen. Für die berufsbegleitende Lösung spreche vor allem, dass sie für viele die einzige Möglichkeit sei, sich überhaupt fortbilden zu können.
Anders als bei der Vollzeitweiterbildung sind die Studierenden älter, in der aktuellen „Teilzeit-Klasse“ überwiegend zwischen 20 und 30 Jahren. Sie haben bereits eine Ausbildung hinter sich, zum Teil eigene Familien und andere Ansprüche sowie Praxiserfahrungen als jüngere Studierende. „Einige sehen es auch als letzte Chance, den Meistertitel doch noch anzupacken. Gelegentlich kommt der Impuls sogar vom Arbeitgeber, um neue Voraussetzungen für den Betrieb zu schaffen“, ergänzt Wolfgang Grab.
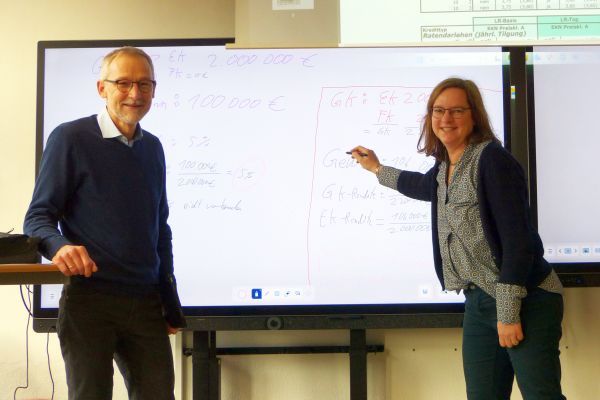
Foto: Marion Feldhaus, Landwirtschaftskammer NRW
Herausforderung: Arbeit plus Schule
Lea Hoffmann, Moritz Künstle und Marc Scheepers sind drei von insgesamt 20 Studierenden aus der aktuellen ELearning-Klasse. Ihr Unterricht findet als sogenanntes Blended-Learning statt: Präsenzunterricht freitags von 8.15 bis 15.30 Uhr und Online-Lernphasen montags und mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr. Dazu steht der Klasse eine digitale Lernplattform (Edupage) mit integriertem Lernplan, Terminverwaltung, Themensammlungen und Präsentationen jederzeit bereit. Sollte also ein Studierender die Unterrichtsstunde verpasst haben, kann er die Inhalte selbstständig und eigenverantwortlich nachholen. Auch die gesamte Kommunikation läuft über die Plattform – das erspart weitere Programme.
Bei genauem Blick ist es jedoch ein Balanceakt, die Weiterbildung neben dem Beruf zu stemmen. Das mache sich besonders zu Aussaat- und Erntezeiten sowie Belastungsspitzen durch Mitarbeiterausfälle oder -urlaubszeiten bemerkbar, beschreiben die drei Studierenden ihren Alltag. „Da musst du über die zwei Jahre schon diszipliniert dranbleiben und es auch wirklich wollen. Doch ohne diese Teilzeitmöglichkeit wäre eine Weiterbildung zum Meisterlandwirt für mich gar nicht möglich“, sagt Marc Scheepers, der im eigenen Familienbetrieb mit Schwerpunkt Ackerbau in Rheinberg arbeitet.

Klassenlehrer Hendrik Austermann (Mitte) unterrichtet seine Schüler Lea Hoffmann, Moritz Künstle und Marc Scheepers (v.l.n.r.) in verschiedenen Fächern.
Den Aufwand abwägen
Das Weiterbildungsmodell als Teilzeitfachschule ist Vollzeitarbeit plus Schule. Somit eine andere Belastung als das Weiterbildungsangebot in Vollzeit – auch finanziell. Bei der Teilzeitform steht den Studierenden kein BAföG als finanzielle Unterstützung zu. Außerdem müssen die drei ihre Unterrichts- und Lernzeiten zum Beispiel durch Urlaubstage, Verrechnung mit Überstunden oder Lohnabzügen in ihren Betrieben kompensieren.
Jedoch sind zum Beispiel die Kosten der Meisterprüfung geringer als bei anderen Berufen. Die Teilnehmer des Blended-Learning-Angebots zahlen insgesamt nur die Gebühren für die Prüfungen und Lernmittel sowie Fahrtkosten. „Es rechnet sich insgesamt vor allem perspektivisch für die Studierenden“, sagt Schulleiter Grab. „Die Gehaltseinstufung als Meister ist in einem Betrieb später anders als mit einer Ausbildung.“ Zudem würden viele Betriebe besonders Bereichs- oder Zweigleiter suchen.
„Es ist kein Zuckerschlecken. Trotzdem freut es mich, diese Weiterbildung ‚nebenher‘ machen zu können. Ich sehe es als große Chance, denn es kann sich nicht jeder herausnehmen, für zwei Jahre Vollzeit in die Schule zu gehen“, erklärt Moritz Künstle, der in einem Betrieb angestellt ist. Auch seine Mitstudierende und Klassensprecherin Lea Hoffmann sieht es als einzige Möglichkeit, sich weiterzubilden, ohne ihren Arbeitsplatz aufgeben zu müssen. Ein Faktor, den auch Klassenlehrer Hendrik Austermann betont: „Für manche ist es eine perspektivische Überlegung. Wenn sie zwei Jahre aus ihrer bisherigen Arbeit heraus wären, könnten sie sich nicht immer sicher sein, dass ihre Stelle im Betrieb bestehen bleibt.“
Bei der berufsbegleitenden Lösung bleiben die Studierenden als Arbeitskräfte in ihrem Betrieb und weiterhin in der Praxis verhaftet. „Wir sehen, was wir lernen, und können es auch direkt umsetzen“, fasst Marc Scheepers weitere Vorteile zusammen. Gleichzeitig hätten sie die Möglichkeit, Erfahrungen in den Unterricht mit einzubringen und sich weitere Ratschläge von ihren Lehrern und Mitstudierenden einzuholen.
Betriebsleitungen mit einbinden
Bisher wurden alle drei Studierenden seitens ihrer Betriebsleitungen gut unterstützt, da letztlich auch der Betrieb von der Weiterbildung profitiere. Doch die Betriebsform und -größe spielten eine entscheidende Rolle. Dazu verrät Lea Hoffmann: „Die Eingewöhnungsphase war für uns nur in den ersten Wochen etwas schwieriger. Es kommt jedoch stark auf den jeweiligen Betrieb an. Wenn ich zum Beispiel nicht melken muss, kann ich auch eher Feierabend machen. In meinem ackerbaulichen Betrieb hat zum Beispiel der Senior meine Schultage in seine Personalplanung direkt fest eingeplant.“ Besonders im Pflanzenbau werde allerdings die Planung witterungsbedingt immer schwieriger, vor allem bei Betrieben mit wenigen Mitarbeitern. „Ich kann dann nicht einfach sagen: Verschieb ich aufs Wochenende – da sind stattdessen auch mal Nachtschichten gefragt“, berichtet Scheepers von seinen Erfahrungen. Neuen Interessenten für die Weiterbildungsform rät er: „Man muss sich von Anfang an fragen, ob man das wirklich möchte und kann. Es hilft, sich einen Plan zu erstellen, dem man konsequent folgt. Die Weiterbildung nur halbherzig zu machen, funktioniert nicht.“ Doch nicht nur die drei zeigen eindrucksvoll, dass es trotz höherer Belastung möglich ist: Von den ursprünglich 24 Teilnehmenden sind 20 dabeigeblieben, 13 machen sogar noch ihre Meisterprüfung.
Die Zukunft im Blick
Was die Studierenden besonders am praxisnahen Unterricht schätzen, ist, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. „Wir sitzen sonst zu sehr in unserer eigenen landwirtschaftlichen Blase und setzen nur fort, was bisher auf unserem Betrieb gemacht wurde. Zukunftsfähige und gesellschaftstaugliche Beispiele sind für uns daher sehr interessant“, bestätigen Marc Scheepers und Moritz Künstle. Es werde immer wichtiger zu lernen, wohin sich Betriebe entwickeln können und müssen. Das ist zum Beispiel für eine mögliche Hofnachfolge relevant oder auch beim Einbinden eines zweiten Betriebsleiters und spezialisierten Bereichsleiters. „In der Weiterbildung zum Meister wird daher auch sehr intensiv vermittelt, Betriebe zu analysieren, zu leiten und zu steuern“, erklärt Lehrer Austermann. Scheepers beschreibt seine neuen Erkenntnisse so: „Betriebswirtschaft ist ein wichtiger Baustein. Bisher war ich nur als Arbeiter tätig und kannte die Zahlen unseres Betriebs nicht. Jetzt kann ich sie analysieren und sehe zum Beispiel erstmals, ob wir morgen pleite wären.“ Hendrik Austermann ergänzt: „Der Blickwinkel ändert sich entscheidend: Jetzt denkt ein Studierender nicht mehr, da steht ein schöner Trecker auf dem Hof, sondern: Da stehen viele Kosten.“
Angepasster Unterrichtsplan
Da die Teilnehmer des berufsbegleitenden Angebots aus unterschiedlichen Agrarbereichen kommen, ist es auch für die Lehrer herausfordernd, ihren Unterrichtsplan zu gestalten. Acht Studierende haben den Schwerpunkt Rind, andere kommen zum Beispiel aus den Bereichen Schweinehaltung, Pflanzenbau, von Mastbetrieben bis hin zu Pferdepensionen. Entsprechend richten die Lehrer den Unterricht auch nach den Interessen der Studierenden aus. „Hier gibt es etwas mehr Gestaltungsspielraum als bei der Vollzeitvariante“, sagt Austermann. „Uns interessieren vor allem andere Betriebszweige und somit auch mögliche Alternativen“, berichtet Lea Hoffmann aus ihrer Klasse. Das seien etwa Themen wie Aquakulturen, Insekten in der Fütterung oder auch die Umnutzung von Gebäuden. Exkursionen zu Betrieben werden mit den Studierenden zusammen abgestimmt, um so möglichst ihre betrieblichen Hintergründe und Strukturen besser berücksichtigen zu können. Vorschläge und Kontakte dazu kommen zum Teil von den Studierenden selbst. So habe die Klasse bereits eine Brüterei besichtigt oder bei der Aufstallung in einem Geflügelmastbetrieb dabei sein können.
Bei den straffen Lerninhalten und wenigen Präsenzzeiten käme allerdings auch das Gemeinschaftsgefühl bei den Studierenden nicht zu kurz, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Manuela Gold-Schnecking. Nicht zuletzt dank gemeinsamer Klassenfahrten oder Aktionen, die von den Studierenden selbst initiiert wurden, wie derzeit etwa die Gestaltung eigener Schulwesten.
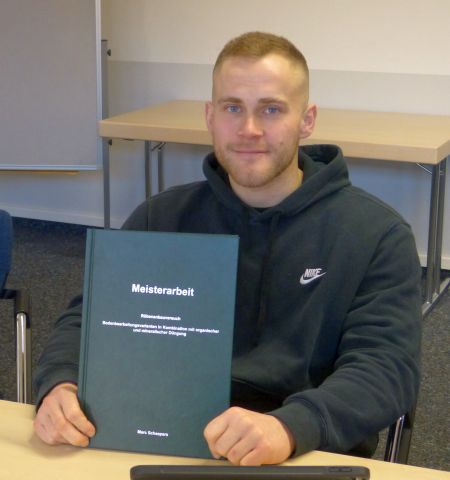
Marc Scheepers hat seine Meisterarbeit mit Rübenanbauversuch bereits fertig – seine abschließenden Prüfungen zum Landwirtschaftsmeister stehen ab Juni an.
Marion Feldhaus, Landwirtschaftskammer NRW