Am 22. Februar fand auf Haus Düsse der 1. Biogeflügeltag NRW der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen statt. 54 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen nach Düsse, weitere rund 40 Interessierte schalteten sich an den heimischen Rechnern dazu.
Die Themen, angefangen bei den Chancen und Risiken der verschiedenen Betriebszweige in der ökologischen Geflügelhaltung, über den aktuellen Markt, die Auslegungen der neuen EU Ökoverordnung und die Einsparungspotenziale bei steigenden Kosten in der Biogeflügelhaltung, waren praxisnah und lebendig vorgetragen.
Auch der Branchentreff, bei dem sich verschiedene Marktbeteiligte der Futtermittelherstellung, Kontrollbehörden, Stalleinrichter, Tierärzte, die Bio-Verbände Demeter, Naturland und Biokreis vorgestellt haben, zeigte die volle Bandbreite dieses Marktes. Die Vorstellung und Demonstration des Geflügelschlachtmobils im Innenhof von Haus Düsse sowie ein Vortrag über die Vergrämung von Raubvögeln rundeten den Biogeflügeltag ab.
Die einzelnen Beiträge der Referentinnen und Referenten werden in den kommenden Wochen an dieser Stelle zu lesen sein. Bei Fragen, Anregungen oder auch dem Wunsch nach mehr Informationen zur Biogeflügelhaltung wenden Sie sich bitte an Axel Hilckmann.
Axel Hilckmann,
Landwirtschaftskammer NRW
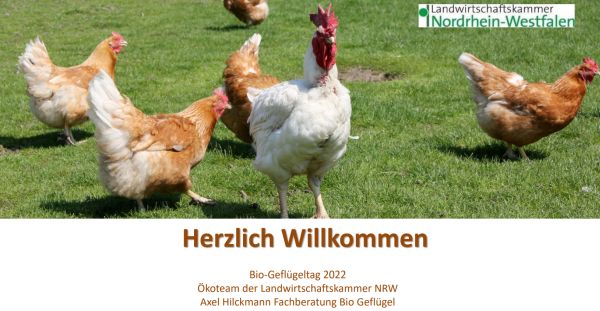
Foto: Axel Hilckmann, Landwirtschaftskammer NRW
Der aktuelle Markt für Bioeier & Geflügel
Axel Hilckmann, Landwirtschaftskammer NRW, fasste die Chancen und Risiken der verschiedenen Betriebszweige für das kommende Jahr zusammen.
Der aktuelle Markt für Bioeier ist im Februar dieses Jahres zweigespalten. In einigen Regionen von Deutschland gibt es bereits jetzt zu viele Eier, wie zum Beispiel in Niedersachsen. Die rasche Zunahme von Biolegehennenbetrieben, die in den letzten fünf Jahren bei plus 25 % lag, hat dafür gesorgt, dass die Packstellen reichlich mit Eier versorgt sind. Anders ist die Situation zurzeit in NRW, wo die Packstellen noch Erzeuger aufnehmen und mit Regionalität und meistens auch Verbandszugehörigkeit der gestiegenen Nachfrage der Verbraucher nach tierartgerecht gelegten Eiern entgegenkommen.
Immer noch kommen neue Mobilställe für die Direktvermarktung dazu, die immer ausgereifter werden und den Bedürfnissen der Tiere entgegenkommen. Die Chancen, in der Direktvermarktung zu punkten, liegen bei jedem Betrieb selber. Hier gibt es zahlreiche Werkzeuge, die jeder Betrieb nutzen sollte, um die Eier erfolgreich zu vermarkten.
Höhere Eierpreise
Auch die Eierpreise sind bereits mit den höheren Erzeugungskosten für Futter, Junghennen und Energie und parallel zur gestiegenen Nachfrage erhöht worden und werden voraussichtlich zum zweiten Halbjahr auf der in den Sommer verschobenen „Biofach“ noch einmal verhandelt werden müssen. Eier gehören nach wie vor zu den meinst nachgefragten Bioprodukten, sind sehr preiselastisch und unterliegen keinen Gesetzmäßigkeiten bezüglich der Höhe des Preises. So gibt es für beide Vermarktungswege, die Direktvermarktung- und die Vermarktung von Eiern über eine Packstelle, viele gute Argumente, Chancen aber auch Risiken.
Einsteigern in die Eiererzeugung ist zu empfehlen, sich nach einer genauen Betrachtung des Standortes zu den Konditionen, Lieferbedingungen und den Erzeugungskosten für ein Bioei genau zu informieren. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass sich die Legehennenhalter auf den nächsten Sommer vorbereiten, wenn die Kunden nach zwei Jahren Corona wieder in Urlaub fahren und somit als Eierkunden ausfallen werden. Hier müssen Alternativen zur Eiervermarktung früh genug geplant werden.
Biogeflügelfleisch als Wachstumsmarkt
Biogeflügelfleisch war 2021 das Produkt mit den größten Wachstumsraten bei der Nachfrage nach Biolebensmitteln und hatte 2021 die höchsten Nachfragezuwächse. Auch heute suchen die Verarbeiter und Vermarkter von Biogeflügelfleisch Landwirte und Erzeuger, die in diesen Betriebszweig einsteigen möchten.
Alle verschiedenen Betriebszweige - Hähnchen-, Puten- oder auch Gänsehaltung - haben sowohl gute Chancen als auch Risiken, die man im besten Fall kennen sollte, bevor man in einen dieser Betriebszweige einsteigt. So liegen die Investitionskosten in der Biohähnchenhaltung bei etwa 50 % der Investitionskosten bei der Eiererzeugung. Das Risiko jedoch liegt in den höheren Anforderungen bei der Schlachtung und Vermarktung von Geflügelfleisch. Der Verdienst in der Hähnchenhaltung ist gut und zu vergleichen mit der Erzeugung von Bioeiern für die Packstelle. Der große Vorteil ist, dass ein Durchgang nach etwa acht bis zehn Wochen an die Schlachterei geliefert wird und nach Reinigung des Stalles wieder mit einem neuen Durchgang begonnen wird. So teilt sich das Produktionsrisiko auf mehrere Durchgänge auf und der Landwirt bestimmt selber, wie schnell nacheinander wieder eingestallt wird.
Sehr großes Potenzial haben die Betriebe, die Hähnchen oder Puten in kleinen Gruppen in der Direktvermarktung den Kunden als frisches Biogeflügel anbieten. Regional erzeugtes Geflügel, langsam wachsend mit viel Auslauf und am besten noch auf dem Hof geschlachtet, überzeugt jeden Kunden. Wer solch ein Hähnchen oder eine Pute einmal gekauft hat, der kommt wieder. Biohähnchen werden in der Direktvermarktung je nach Lage zwischen 10 € und 12 € pro kg vermarktet.
Bioputenfleisch ist für viele Kunden immer noch sehr schwer zu beziehen und Betriebe, die hier einsteigen, treffen auf eine große Nachfrage. Die Pute gehört jedoch zweifellos zu den Geflügelarten, die das meiste Fingerspitzengefühl beim Tiermanagement verlangt. Die Biogans als Saisongeflügel verzeiht wesentlich mehr, sie ist sehr robust - und das Schöne dabei ist: Nach Weihnachten ist alles wieder vorbei und Ruhe kehrt ein. Hier jedoch ist die Schwierigkeit, zur richtigen Jahreszeit die passende Schlachterei zu finden. Bereitet man sich früh genug im Jahr auf diesen Termin vor, dann ist die Gänsehaltung eine schöne und auch wirtschaftliche Alternative. Pro ha Weidefläche sind etwa 80 Gänse möglich. Im Stall zählen 21 kg/m². Das wären bei 7 kg schweren Gänsen drei Tiere pro m² im Stall. Gänse brauchen außerdem eine Wasserfläche zum Schwimmen.
Axel Hilckmann,
Landwirtschaftskammer NRW

Foto: Axel Hilckmann, Landwirtschaftskammer NRW

Foto: Axel Hilckmann, Landwirtschaftskammer NRW